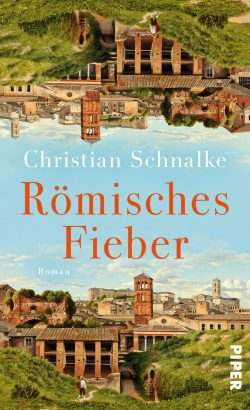Römisches Fieber. Mama Miracoli wird’s freuen –
Ein braver aber benachteiligter junger Dichter nimmt die Identität eines anderen an und wird so Teil der Künstlerszene in Rom am Beginn des 19. Jahrhunderts. Der Identitätsdiebstahl war schon für Patricia Highsmith, Daphne de Maurier und viele andere eine dankbare Vorlage für Geschichten, in denen die Protagonisten dazu gezwungen waren, darüber nachzudenken, was die Identität eines Menschen ausmacht. Die Summe seiner biografischen Daten? Seine Leistungen? Der Blick der anderen? Und es gibt wohl kaum einen Menschen, der sich nicht schon einmal vorgestellt hat, über Nacht die Identität einer anderen Person anzunehmen, sein Lebenskonto noch einmal auf Null zustellen oder eben herauszufinden, ob das überhaupt möglich ist und wie man es wohl anfangen würde, wenn man diese Gelegenheit bekommt {oder sie sich nimmt}.
Von solchen Fragen an die menschliche Existenz findet sich nichts in »Römisches Fieber«, zum Glück, werden manche sagen, schade und verschenkt, denken andere. Ich gehöre zu letzteren. Es ist immer bedauerlich, wenn man Fragen an einen Roman hat, die dieser nicht beantwortet. Stattdessen folge ich also Franz, der die Identität des ertrunkenen Cornelius Lohwald angenommen hat, durch die Gassen Roms. Ich lerne mit ihm allerlei klangvolle Namen kennen {die meisten historisch verbürgt}, ich sitze unter Zypressen, zwischen Ruinen, im Mondschein usw. Das ist nicht nur stimmungsvoll gemacht, es übersetzt auch in Sprache, was die Maler der Romantik auf die Leinwand brachten, und aus diesen Malern besteht die Künstlerszene vor allem. Wer schon einmal eine Gemäldegalerie besucht hat, kann hier ohne weiteres Szenerien ergänzen: Schafhirten unter Olivenbäumen, Mönche in antiken Ruinen, Wolkentürme über der Engelsburg, Goethe unter blühenden Zitronenbäumen. Zweifellos also das richtige Buch für alle, die Rom so sehen wollen, wie es nie war. Und wenn dann in einem Hinterhof in lauer Nacht mit einer lauten italienischen Familie getafelt wird, glaubt man Mama Miracoli rufen zu hören und hat die leichte Befürchtung, die Grenze zum Kitsch wurde überschritten.
Das dreckige Rom sehen wir nie. Und auch die Künstler untereinander sind edel, hilfreich und gut. Es gibt weder Neid noch Missgunst {bis auf einen bösen Literaturkritiker, aber die sind ja immer Spielverderber}. »Künstlerfreunde« ist vermutlich eines der am häufigsten verwendeten Hauptworte: Sie feiern einander, sie empfehlen einander, sie loben einander. Hach, die gute …