»Man kam nicht her, um zu genesen, sondern um zu sterben.«
Histo Journal Buchbesprechung: Vera Buck »Runa«
Gelesen & Notiert von Ilka Stitz
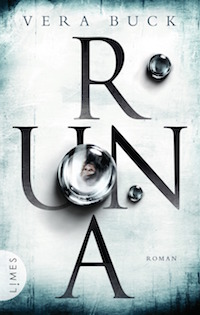
Vera Buck
Runa
Paris 1884. In der neurologischen Abteilung der Salpêtrière-Klinik führt Dr. Charcot Experimente mit hysterischen Patientinnen durch. Seine Hypnosevorführungen locken Besucher aus ganz Europa an; wie ein Magier lässt der Nervenarzt die Frauen vor seinem Publikum tanzen. Dann aber wird Runa in die Anstalt eingeliefert, ein kleines Mädchen, das all seinen Behandlungsmethoden trotzt.
Jori Hell, ein Schweizer Medizinstudent, wittert seine Chance, an den ersehnten Doktortitel zu gelangen, und schlägt das bis dahin Undenkbare vor. Als erster Mediziner will er den Wahnsinn aus dem Gehirn einer Patientin fortschneiden. Was er nicht ahnt: Runa hat mysteriöse Botschaften in der ganzen Stadt hinterlassen, auf die auch andere längst aufmerksam geworden sind. Und sie kennt Joris dunkelstes Geheimnis …
Weitere Informationen zum Roman und zur Autorin {u.a. Leseprobe & Interview} auf der Website des Limes Verlages.
Hart an der Grenze
Runa ist ein Roman, der dem Leser einiges abverlangt. Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder die ungeschönte Wahrheit aushalten kann, die Wahrheit über die Anfänge großer wissenschaftlicher Erkenntnisse, in diesem Fall die der Psychiatrie. Aber wahrscheinlich hat jeder ein Bild der sogenannten Nervenheilanstalten des 19. Jahrhunderts vor Augen: Menschen, die in Bottichen sitzen, mit Schläuchen abgespritzt oder in Becken untergetaucht werden – man erinnere sich an den Horrorfilm Wolfman, in dem der Vater, gespielt von Anthony Hopkins, seinen vermeintlich irren Sohn {Benicio del Toro} einer Wassertherapie unterwirft, indem er ihn wieder und wieder in einem Becken versenken lässt … Eine ›Behandlung‹, die nicht nur an Foltermethoden wie Waterboarding erinnert, sondern ihnen gleichkommt. Andererseits sind genau diesen Ärzten, die solche Methoden anwandten, einschneidende Erkenntnisse über die Neurochirurgie zu verdanken, oder jener Erkrankungen wie das nach Georges Gilles de la Tourette benannte Tourette-Syndrom. In dem Roman »Runa« bekommen diese Namen ein Gesicht, eine Persönlichkeit. Die Versuche, die Ideen, die Vorgehensweisen entspringen nicht dem Gehirn eines Horrorschriftstellers, sondern der Geschichte. Einer Geschichte, die auch in den Nebenhandlungen und Details, so wie sie in diesem Roman geschildert werden, durchaus stattgefunden haben könnte. Und das ist das Erschreckende, das Verstörende und gleichzeitig das überaus Faszinierende an diesem Roman. Denn Vera Buck erzählt ihre Geschichte in einem eher unbeteiligten, objektiven Ton. Sie verurteilt nicht, sie beschreibt. Sie schmückt nicht aus, sie bildet ab. Und das sehr eindringlich und glaubwürdig.
Der Held des Romans, der Schweizer Medizinstudent Johann Richard Hell, arbeitet an der Salpetrière in Paris, der Doktortitel ist sein Ziel. Hier sind einige hundert Patientinnen untergebracht. Neu an dieser Klinik ist, dass die Patientinnen nach Krankheitsbildern kategorisiert werden, es gab »die Nervenkranken, die Gehirnweichen und die Epileptischen; es gab die Tumorpatienten und die Muskelkranken, es gab Frauen, denen man die Chance auf Genesung zusprach und solche, bei denen man jede Hoffnung aufgegeben hatte. Und dank der Größe der Klinik stand für jede dieser Gruppen eine eigenen Abteilung zur Verfügung.« {S. 161} Und den Ärzten bot sich ein schier unerschöpflicher Hort an Versuchspersonen, Material, denn viele der Frauen sind Heimatlose, Abgeschobene oder Alleinstehende, die niemand vermisst.
Johann Richard Hell, genannt Jori, ist begeistert von den Forschungen, die neue Erkenntnisse bringen. Die Wissenschaft fordert natürlich Opfer, doch dieses notwendige Übel nimmt er bereitwillig in Kauf. Als einer der aufmerksamsten Studenten lässt er keine Vorlesung des Klinikleiters Dr. Charcot aus. Dessen ›Hypnosevorstellungen‹ erinnern allerdings eher an Zirkusvorstellungen, denn an wissenschaftliche Vorlesungen. Rund 200 Besucher fasst das ›Theater‹, auf dessen Bühne jeden Dienstag Abend seine aufsehen erregenden Darbietungen stattfinden. Hier werden Patientinnen nicht nur unter Hypnose dazu gebracht, allerlei Befehle auszuführen, sondern sie werden auch an sogenannten hysterogenen Punkten traktiert, um Anfälle auszulösen und den Studenten die unterschiedlichen Erscheinungsformen der jeweiligen Erkrankung vor Augen zu führen. Die Situation ist überdeutlich: auf der Bühne die ausgelieferten Frauen, wehrlos wie Marionetten vorgeführt, die Zuschauer ausnahmslos Männer, deren Interesse an den Vorführungen nicht ausschließlich ihrem medizinischem Forschungsdrang entspringt. Die Atmosphäre ist sexuell aufgeladen, die Erregung der Zuschauer in diesen Szenen spürbar. Diese Darbietung, das wird offensichtlich, schließt sich nahtlos an die Schilderung von Hexenprozessen an, und setzt sich in den Konzentrationslagern der Nazis fort. Immer war man überzeugt, richtig zu handeln, der gesunden Menschheit zu dienen.

wird das berühmte Gemälde des Malers André Brouillet enthüllt –
es zeigt Charcot mit Blanche Wittmann,
einer Hysterie- Patientin {bzw. Schauspielerin}, vor illustrem Publikum.
Das Bild wurde zum zweitberühmtesten Gemälde
der Medizingeschichte, gleich nach Rembrandts »Anatomie des Dr. Tulp«
Was nicht in das gesellschaftlich anerkannte Modell ›Frau‹ passt, ist krank. Letztlich kann es sich dabei doch nur um eine Deformation des Gehirns handeln, und diese Krankheit, so die wissenschaftstrunkene Meinung der {selbstredend männlichen} Ärzte, muss doch heilbar, reparabel, sein! Das Fehlerhafte muss man nur wegschneiden. Hauptsache, die Frau fällt am Ende nicht mehr auf. Als Erfolg gilt, wenn sie nach einem Eingriff zwar nur noch las eine sabbernde Kreatur dahinvegetiert, die aber still ist, und bestenfalls noch allein essen kann.
Jori hat allerdings sehr persönliche Motive, den ›Wahnsinn‹ zu erforschen. Seine große Liebe Pauline, die Schwester seines Freundes Paul, ist eine dieser Frauen, die nicht in das gesellschaftliche Konzept passen. Ihretwegen forscht Jori mit Hochdruck an einem neuen Weg, der Heilung verspricht.
Als die Waise Runa eingeliefert wird, steht schnell fest, dass dieses Mädchen anders ist als alle anderen Patientinnen. Bei ihr versagt Charcots Hypnose, sie lässt sich nicht einschüchtern, sondern im Gegenteil, erzeugt selbst Angst. Auf Jori übt das Kind eine besondere Anziehungskraft aus. Er beschließt ihr – und damit sich selbst – zu helfen. Sie soll die erste Patientin werden, die durch eine Operation geheilt wird. Das wäre eine Sensation! Jori gewinnt den Neurologen Jules Bernard Luys für seinen Plan: Eine Operation, die den Ruf von Charcots Salpetrière mehren soll, Dr. Luys weltweiten Ruhm bescheren und Jori Hell den ersehnten Doktortitel einbringen soll. Der Titel, der es Jori ermöglichen würde, seine geliebte Pauline selbst zu behandeln und sie somit vor dem Zugriff der altmodischen Schweizer Psychiatrie zu retten.
Doch das Mädchen durchkreuzt alle Pläne. Sie hat bereits in ganz Paris Zeichen gesetzt, Zeichen, die Aufmerksamkeit erregt haben. Die von Monsieur Lecoq nämlich, dem ehemaligen Kommissar der Pariser Sûreté. der skurrile Ex-Kommissar wächst dem Leser schnell ans Herz. Er ist erbitterter Anhänger der Theorie des Cesare Lombroso, dessen »Die Physiognomie der Verbrecher« kennt er auswendig. Die Erkenntnisse dieser Lektüre führten zwangsläufig zu seinem Ausscheiden aus der Sûreté, hat er selbst doch die typische Erscheinung eines Kriminellen. Letztlich, so seine Erkenntnis, war er doch nur deswegen ein so erfolgreicher Polizist, weil es ihm naturgemäß leicht fällt, sich in einen Verbrecher hineinzuversetzen. Als er vor sechzehn Jahren den Polizeidienst quittierte, tat er nichts anderes, als seiner wahren Berufung zu folgen. Das führt zu merkwürdigen Begegnungen mit einstigen Kollegen: »Der Inspektor warf einen zweifelnden Blick auf die zugerichtete Frau am Boden. Er hatte Lecoqs Ausführungen bislang mit höflichem Interesse verfolgt, doch nun schienen ihm echte Zweifel am Verstand seines Gegenübers zu kommen. Es musste ihm ohnehin schwerfallen, einen Mann ernst zu nehmen, der ganz offiziell seinen Dienst als Inspektor quittierte, um Verbrecher zu werden. Und der sich dann nie etwas zuschulden kommen ließ.« {S. 269}
Lecoq ist der Konterpart zu Jori und sorgt für die Lichtstreifen am düsteren Horizont des Krankenhausalltags in der Salpetrière. Und wem der Name Lecoq vertraut ist, wird vermutlich auch noch weitere Bekannte in dem Roman antreffen. Und nur soviel sei verraten, dass sich dadurch eine ganz andere Facette des Romans zeigt.
Es ist eine gleichermaßen faszinierende wir grauenvolle Lektüre, die Vera Buck dem Leser zumutet. Denn durch ihre sachliche Sprache, die authentischen Charaktere, gewinnt das Grauen ein Gesicht, eine Persönlichkeit. Man versteht die Personen, ihre Vorgehensweise, auch wenn man sie nicht billigt. Der Leser weiß schließlich, welche Erkenntnisse die die Psychiatrie durch die hier vorgestellten Personen gewonnen hat. – Eine ausführliche Literaturliste am Ende des Romans dokumentiert die wissenschaftlichen Hintergründe und Ergebnisse der Forschung, denn Charcot, Luys und andere haben tatsächlich Medizingeschichte geschrieben. Aber die Methoden, durch die es zu diesen Erkenntnissen kam, kannte ich zumindest noch nicht, und eigentlich hatte ich es so genau auch nicht wissen wollen. Und doch konnte ich das Buch nicht aus der Hand legen. Vor allem liegt das natürlich an der spannenden Geschichte selbst, und vermutlich auch an der Faszination des Grauens. Diesem sehr realen Grauen, erzeugt durch historische Figuren und Fakten, die Vera Buck beschreibt. All dies zudem exzellent recherchiert, soweit ich das beurteilen kann.
Fazit
Selten wurde so deutlich gezeigt, welch ein Eldorado gerade das 19. Jahrhundert für Ärzte gewesen sein muss. Wie sehr sich die Ärzte Gottgleich fühlten und ihre Handlungen durch dieses Allmachtsgefühl zu rechtfertigen verstanden, sofern Rechtfertigung denn überhaupt Not tat. Und wie sehr sie die übrige Menschheit als unter sich stehend betrachtet haben müssen, als eine Art Kröten, deren Existenz allein gerechtfertigt ist, um als ›Material‹ für sie, für ihre Erkenntnisse zur Verfügung zu stehen. Vorgeblich zum Nutzen der Allgemeinheit, der Gesunden, in Wirklichkeit aber dienen die Versuche vorrangig zu dem persönlichen, geistigen und materiellen, Nutzen der Ärzte. So ist es vor allem die Erkenntnis, dass im Namen der Wissenschaft, vor allem der Medizin – der man ja geneigt ist, zum Vorteil der Menschheit viel zu erlauben – nicht alles gestattet sein darf. Nein, die Zeiten der »›Götter in Weiß‹ sollten vorbei sein. Und im Buch wenigstens bringt ein Mädchen namens Runa, das Haltung bewahrt, ihre Würde behält und allein dadurch die Arroganz der Ärzte erschüttert, diese erleichternde Wende.
Das Buch ist nicht ohne Grund und meiner Meinung nach völlig zu Recht für den Friedrich-Glauser-Preis 2016, in der Sparte Debüt, des Syndikats nominiert. Dieser historische Medizinthriller ist so dicht und reif erzählt, dass es schwer ist zu glauben, dass es der erste Roman dieser jungen Autorin ist. Auf jeden Fall lässt er noch viel erwarten.
Die Autorin
Vera Buck, geboren 1986, studierte Journalistik in Hannover und Scriptwriting auf Hawaii. Während des Studiums schrieb sie Texte für Radio, Fernsehen und Zeitschriften, später Kurzgeschichten für Anthologien und Literaturzeitschriften.
Nach dem Studium wurde sie für den Master of Arts »Crossways in Cultural Narratives« {Schirmherrschaft der Europäischen Kommission} ausgewählt und studierte in Frankreich, Spanien und Italien. 2011 erhielt sie von der Studienstiftung des deutschen Volkes ein Stipendium für die Sommerakademie ›Writing Science in Fiction‹ in St. Johann, Italien. Seit Februar 2012 studiert sie im Master ›Transdisziplinarität‹ an der Zürcher Hochschule der Künste und schreibt Prosa und Gedichte.
Zur Website der Autorin.
